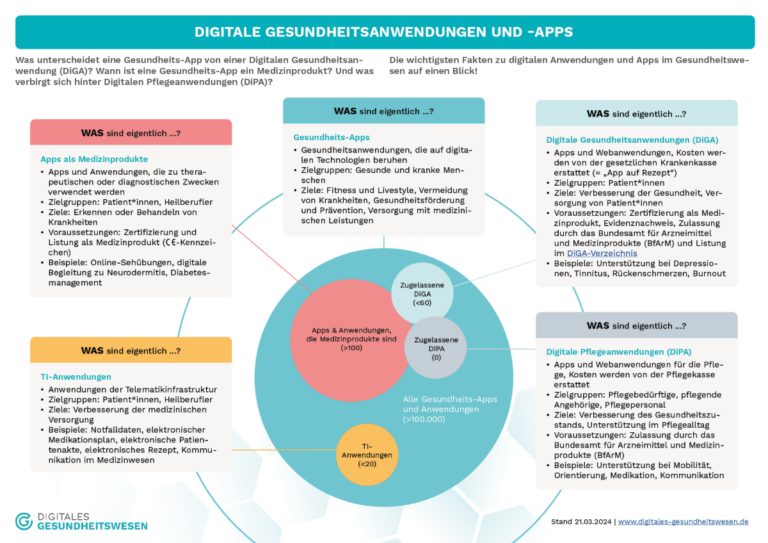Im Jahr 2019 traten die Professoren Reinhard Busse und Boris Augurzky medienwirksam mit den Ergebnissen der Bertelsmann-Studie „Zukunftsorientierte Krankenhausversorgung“ in der ARD-Dokumentation „Krankenhäuser schließen – Leben retten?“ auf. Deren Fazit: In Deutschland gibt es zu viele Krankenhäuser. Eine starke Verringerung der Klinikanzahl auf rund ein Drittel der aktuellen Zahl würde die Qualität der Versorgung für Patienten verbessern und bestehende Engpässe bei Ärzten und Pflegepersonal mildern. Vier Jahre und eine überstandene Corona-Pandemie später plant Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Krankenhausreform und will die derzeit noch bundesweit etwa 1.800 Krankenhäuser drastisch umbauen: Mehr ambulante, weniger stationäre Aufenthalte lautet der Plan. Viele Bundesländer befürchten, dass dadurch insbesondere kleine Kliniken schließen müssen. Sie könnten recht behalten.
Denn den Kliniken scheint ohnehin allmählich die Luft auszugehen: Ein Lagebild der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) prognostiziert für das kommende Jahr eine beispiellose Pleitewelle
„Auf unsere Kliniken rollt 2023 eine Insolvenzwelle zu, die sich kaum mehr stoppen lässt“
, sagte Verbandschef Gerald Gaß bereits Ende 2022. Der Schaden für die medizinische Versorgung werde 2023 in vielen Regionen sichtbar werden, betonte er unter Verweis auf das aktuelle Krankenhaus-Barometer des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI), einer jährlich durchgeführten Repräsentativbefragung der Allgemeinkrankenhäuser in Deutschland. Danach rechnen 59 Prozent der Kliniken für das abgelaufene Jahr 2022 mit roten Zahlen. 2021 betrug dieser Anteil noch 43 Prozent.
Besorgniserregende Personalsituation

Der Anteil der Krankenhäuser mit einem positiven Jahresergebnis wird sich der Umfrage zufolge mehr als halbieren, und zwar von 44 auf voraussichtlich 20 Prozent, so das Krankenhaus-Barometer. 2023 dürfte sich das strukturelle Defizit aller Kliniken auf rund 15 Milliarden Euro summieren. Besorgniserregend bis existenzgefährdend ist zudem die Personalsituation in den Kliniken. Zum einen in der Pflege, wo zur Jahresmitte 2022 fast 90 Prozent der Krankenhäuser Probleme hatten, offene Pflegestellen auf den Allgemeinstationen zu besetzen – in der Intensivpflege hatten drei von vier Krankenhäusern Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung. Zum anderen im Bereich IT: „Den Kliniken fehlen an allen Ecken die IT-Experten, um die ganzen Anforderungen an die Digitalisierung umzusetzen“, weiß Dipl. Informatiker Michael Engelhorn, IT-Experte und Medizininformatiker bei ExperMed GmbH Berlin, einem Netzwerk von Experten im Gesundheitswesen.
Zum Artikel „Die Digitalisierung allein ist kein Allheilmittel“ mit Michael Engelhorn
Sein ernüchternder Befund: „Wir haben ein Gesundheitssystem, das sehr krank ist, weil es sich seit Jahrzehnten nicht an die veränderte Umgebung angepasst hat. Zum Beispiel die demografische Altersstruktur, aber auch die medizinischen Möglichkeiten, die sehr teuer sind. Ein MRT kostet eine viertel bis eine halbe Million Euro. Da wird dann untersucht von vorne bis hinten, koste es was es wolle. Dazu kommen die vernachlässigten Klinikstrukturen und dann gibt es noch die Bremser in den Ärzteverbänden, den Gemeinsamen Bundessauschuss, die Kassen, die Länder- und Bundesverbände, die Landesregierungen, die auf ihre Kompetenz bei der Krankenhausplanung pochen, Landräte, die auf keinen Fall Krankenhäuser schließen möchten: Jeder hat seine eigenen Interessen und da steht oft nicht das Gesamtergebnis für das Gesundheitswesen im Vordergrund.“
Für einen Heilungsweg beim deutschen Patienten sieht er immerhin erste vernünftige Therapieansätze: „Die geplante Aufweichung der Sektorengrenzen in stationär, hybrid und ambulant wird mit Sicherheit organisatorische Veränderungen in den Krankenhäusern nach sich ziehen. Der Kostendruck wird weiterhin Veränderungen bedingen.
Die geplante Dreiteilung in Häuser der Grundversorgung, Regel- und Schwerpunktversorgung sowie Maximalversorgung wird zu weiterer Spezialisierung und Klinikzusammenschlüssen führen. Nicht jedes Krankenhaus kann und soll sich – schon aus Kostengründen – alle Fachdisziplinen leisten. Der Austausch der medizinischen Leistungen im Verbund wird damit eine Notwendigkeit werden.“
Kleine Kliniken entsprechen nicht mehr dem Versorgungsbedarf einer Region

Auch eine aktuelle Studie der Stiftung Münch, durchgeführt von der Institute for Health Care Business GmbH (hcb) und der Oberender AG stellt schonungslos fest, dass viele kleine Kliniken der Grundversorgung nicht mehr den Versorgungsbedarfen einer Region entsprechen. Um Personal, Technik und Infrastruktur vorzuhalten, entstehen hohe Kosten. Sie sind daher oft defizitär und es sind regelmäßig Summen in Millionenhöhe nötig, mit denen Kommunen und Landkreise die aufgelaufenen Defizite ausgleichen müssen. Geld, dass dringend an anderer Stelle benötigt werde. „Doch in der Regel scheuen sich Lokalpolitiker, einen Klinikstandort zu schließen. Bei einer angedachten Schließung ist in der Regel mit einem starken Gegenwind aufgebrachter Bürger zu rechnen, die unter anderem ihre Notfallversorgung gefährdet sehen“, heißt es in der Studie. So wie jüngst im Dezember 2022 im Landkreis Weilheim-Schongau: Dort wird es nach einem Bürgerentscheid vorerst keine Planungen für ein Zentralklinikum geben. Zwei Drittel der Teilnehmer sprachen sich für den Erhalt von zwei Krankenhäusern im Landkreis aus – gegen den Willen der Politik vor Ort sowie des Bayerischen Gesundheitsministers in München.
„Gesundheitspolitik ist eben auch lokal“, sagt Dr. Adrian Schuster, Unternehmensberater in der Gesundheitswirtschaft und IT-Experte und Arzt im health-h Branchennetzwerk.
„In Bayern haben die Freien Wähler zum Beispiel durchgesetzt, dass keine Klinik geschlossen wird. Etwa die Hälfte der bayerischen Kliniken haben unter 150 Betten und weniger. Aber unter 300 Betten ist eine Klinik nicht wirtschaftlich und mit hoher Qualität zu betreiben, es sei denn es handelt sich um eine Spezialklinik. Rheinland-Pfalz hat hingegen definiert, was als gesundheitspolitischer Maßstab für die Bevölkerung vorgesehen ist: In 30 Minuten müssen die Bürger ein qualifiziertes Krankenhaus für die Grundversorgung erreichen. Da können in Ballungsgebieten aus drei Kliniken eine gemacht werden.“ Und laut der erwähnten Bertelsmann-Studie könnte in der Modellregion Köln/Leverkusen in Nordrhein-Westfalen die Zahl der Krankenhäuser von 38 auf 14 reduziert werden. „Aber welche der Kliniken dann auch im Rahmen der von Karl Lauterbach angedachten Reduzierung geschlossen wird, dafür ist kein konkreter Plan in Sicht und wird noch viele Diskussionen erfordern. Da dürfte es in der Praxis wohl ein Hauen und Stechen der Bürgermeister und Landräte geben. Das wird den Prozess noch gewaltig verzögern. Vereinzelt können Regionalpolitiker ja sogar defizitäre Kliniken jahrelang durchziehen und mit Steuermillionen unter die Arme greifen“, sagt Dr. Schuster.
KHZGGesetz zur finanziellen Förderung der Digitalisierung von Krankenhäusern … mehr erfahren verlängert die Lebensdauer unrentabler Kliniken
Auch der Therapieansatz, mit den 4,3 Milliarden Euro aus dem KrankenhauszukunftsgesetzGesetz zur finanziellen Förderung der Digitalisierung von Krankenhäusern … mehr erfahren für eine schnellere Marktbereinigung zu sorgen, bewirkt gerade das Gegenteil und verlängert die Lebensdauer so mancher unrentablen Klinik, so der Experte. „Mehrheitlich gilt das Gießkannen-Prinzip, alle bekommen Geld aus Gründen einer angenommenen Gerechtigkeit.
1600 von rund 1900 Kliniken haben das beantragt. Das deutet dann schon stark auf eine Fehlallokation der Ressourcen hin. Da werden Einrichtungen unterstützt, die kaum noch überlebensfähig sind. Auch wenn es grundsätzlich sinnvoll ist, den größten deutschen Wirtschaftszweig mit Digitalisierung auf Vordermann zu bringen. Es gibt ja gute und gesunde Kliniken, die bereits viel IT einsetzen und davon profitieren. Aber wenn es größere Investitionsstaus gibt, ist nicht mehr viel zu retten. Da kann man noch so viel digitalisieren, die möglichen Gewinne werden für die nötigen Investitionen nicht ausreichen.“
Wie in umstrittenen Fällen das Krankenhaus vor Ort so umgewandelt werden könnte, dass eine gute Versorgung erhalten bleibt, beantwortet die Studie der Stiftung Münch. Sie empfiehlt drei verschiedene Typen von Einrichtungen, in die das klassische Krankenhaus transformiert werden kann: eine ambulante Klinik, eine Überwachungsklinik oder eine Fachklinik. Die ambulante Klinik stellt als Anlaufstelle für einen Großteil der gesundheitlichen Anliegen eine Basisversorgung sicher. Die freiwerdenden Räume des Krankenhauses werden genutzt, um ambulante Angebote zusammenzuführen und durch neue zu ergänzen. Auf diese Weise sind viele Gesundheitsdienste an einem zentralen Ort für die Bevölkerung leicht zu erreichen. „In ambulanten OP-Zentren können schon heute knapp 3.000 Arten von Operationen ohne Aufenthalt in einem Krankenhaus erfolgen. Und diese Zahl wird weiter steigen“, heißt es in der Studie. Denn die ambulante Versorgung wird zunehmend durch Telemedizin und Telemonitoring unterstützt. Durch die Erfassung von Vitalparametern in Echtzeit können chronisch Erkrankte (z. B. bei Herzinsuffizienz) ambulant überwacht werden, so dass im Falle einer Verschlechterung des Zustands umgehend ein Arzt aufgesucht werden kann. In Kombination mit Präventionsansätzen kann die ambulante Versorgung manchen Klinikaufenthalt ersetzen und eine Genesung zu Hause ermöglichen.
Das Krankenhaus der Gemeinde Möckmühl (etwa 8.000 Einwohner) im Landkreis Heilbronn hat sich zum Beispiel in diese Richtung entwickelt: Als Krankenhaus der Grundversorgung mit etwa 80 vollstationären Betten für die Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie und Unfallmedizin wurde es immer schwieriger, ausreichend Personal zu bekommen. An eine wirtschaftliche Betriebsführung war nicht zu denken. Durch einen Veränderungsprozess, der unter den verschiedenen Interessensgruppen abgestimmt wurde, erfolgte 2018 die Umwandlung in ein ambulantes Gesundheitszentrum. In Notfällen sind die nächstgelegenen Krankenhäuser innerhalb von 30 Minuten erreichbar. Zugleich wurden weitere Dienste in das ambulante Gesundheitszentrum integriert: ein Therapiezentrum mit Krankengymnastik, Physiotherapie und Massagen sowie ein Sanitätshaus und ein Pflegestützpunkt.
Wohnortnahe Überwachungskliniken als Option einer Umwandlung
Bei langen Wegen zu größeren Krankenhäusern könnten auch wohnortnahe Überwachungskliniken eine Option sein, so die Studien-Autoren Sven Lueke, Senior Berater beim Institute for Health Care Business (hcb) und Gesundheitsökonom Andreas Schmid von der Oberender AG. FOTO Sven Lueke, hcb und/oder Andreas Schmid, Oberender AG
Anders als in ambulanten Kliniken könnten Patienten bei Bedarf dort für ein oder zwei Nächte aufgenommen werden. „Das Angebot deckt komplexere ambulante Fälle ab, für die im Fall einer Komplikation eine Übernachtung nötig wird oder bei denen aus sozialen Gründen eine Heimreise am gleichen Tag nicht empfehlenswert ist“, heißt es in der Studie. Hochtechnisierte Infrastruktur einer Klinik und durchgehende ärztliche Präsenz sei dabei nicht erforderlich. Gute ärztliche Diagnostik, verlässliche Verlaufsabschätzung und kontinuierliche Überwachung durch qualifizierte Pflegefachkräfte sichere hier die Versorgungsqualität.
In bestimmten Fällen kann sich ein Krankenhaus auch auf ausgewählte Spezialgebiete fokussieren. Das kann dann gelingen, wenn eine Fachabteilung bzw. ausgewählte Leistungsbereiche eines Krankenhauses eine überregionale Anziehungskraft entwickeln.
Die Grund- und Notfallversorgung würde dann durch andere Angebote sichergestellt werden, zum Beispiel durch Rettungsdienst, Arztpraxen und umliegende Krankenhäuser. So war die Klinik Uffenheim mit rund 80 Betten für die Abteilungen Innere Medizin, Chirurgie sowie geriatrische Rehabilitation die kleinste der drei kommunal getragenen Kliniken im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. Der Fortbestand der Klinik war fraglich, der Betrieb war nur bei Akzeptanz dauerhafter wirtschaftlicher Defizite möglich. Im Jahr 2013 wurde mit den Heiligenfeld Kliniken eine etablierte Klinikgruppe mit dem Schwerpunkt psychosomatische Medizin gefunden, die das Krankenhaus kaufte. Nach dem Erwerb erfolgte die Umwandlung in eine Fachklinik für psychische und psychosomatische Erkrankungen. Die neu gegründete Heiligenfeld Klinik Uffenheim wird seit 2019 mit wirtschaftlichem Erfolg betrieben. Die medizinische Akut- und Notfallversorgung der Bevölkerung wird durch die umliegenden Krankenhäuser gewährleistet.

Von den drei Möglichkeiten ist keine per se besser oder schlechter, betont Professor Boris Augurzky, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Münch und Mitglied in der „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“ des Bundesministeriums für Gesundheit: „Das Zielbild ist dann gut, wenn es den Bedarf der Region trifft und die Qualität der Versorgung damit besser ist als bei einer Fortschreibung des Status quo.“
Um die vor Ort geeignete Einrichtung zu finden, müssen die jeweiligen lokalen Voraussetzungen geprüft und die Bedürfnisse ermittelt werden. Ergänzende Versorgungsbausteine stellen sicher, dass bei der Umwandlung die Versorgungsqualität erhalten bleibt. Dazu gehören zum Beispiel die Integration neuer Berufsgruppen, die Nutzung von Telemedizin, die Einbindung von Haus- und Facharztpraxen oder das Angebot von ambulanten Operationen.
Das Konzept der regionalen Gesundheitszentren
Um Ärzte in strukturschwachen Regionen zu halten und mehr sektorenübergreifende Behandlung hinzubekommen, hat der Verband der Ersatzkassen (VdEK) ein neues Modell vernetzter Versorgung entwickelt: Er fordert den bundesweiten Aufbau von regionalen Gesundheitszentren (RGZ). Damit könnten nicht nur wichtige Funktionen von unrentabel gewordenen Kleinkrankenhäusern übernommen, sondern auch vorhandene Ressourcen effizienter genutzt und erweiterte Formen von Kooperation entwickelt werden. Außerdem, so der Verband, schaffe man dadurch gerade für junge Mediziner, die sich nicht auf ein Einzelkämpfertum mit eigener Praxis einlassen wollten, attraktive und flexible Arbeitsbedingungen. Was zunächst nach Medizinischem Versorgungs-Zentrum (MVZÄrztlich geleitete Einrichtungen von mindestens zwei Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen … mehr erfahren) klingt, soll in der Umsetzung deutlich anders aussehen, wie der Abteilungsleiter für ambulante Versorgung beim VdEK, Boris von Maydell, erläutert. „Bereits heute gibt es in Deutschland 3500 Medizinische Versorgungszentren“, sagt er. „Doch die wenigsten dieser oft von privaten Finanzinvestoren betriebenen Häuser verfolgen den Ansatz, die Patientenbehandlung wirklich fachübergreifend sicherzustellen. Stattdessen sind die bestehenden MVZ oft auf renditestarke Geschäftsfelder ausgerichtet und betreiben Leistungspicking.“
Das Modell der „Versorgung unter einem Dach“, wie es den Ersatzkassen vorschwebt, sieht anders aus: Es soll vor allem aufs Land – und dort so viele Behandlungsangebote wie möglich bereitstellen, basierend auf gesicherter hausärztlicher Versorgung.
Deshalb sind dem Konzept zufolge pro RGZ auch mindestens vier Allgemeinmediziner vorgesehen, die dort dann mit weiteren grundversorgenden Fachärzten – etwa für Innere Medizin, Orthopädie, Augenheilkunde oder auch Psychotherapie – zusammenarbeiten könnten. Ergänzt würde das Ganze durch Heilmittelerbringer wie Physiotherapeuten, weitere Fachärzte, Apotheken oder Sanitätshäuser, Gemeindeschwestern, Kurzzeitpflege. Auch einfache ambulante Operationen könnten in den RGZ stattfinden. Überwachungsbetten wären dort ebenso möglich wie eine Notfallversorgung. Aufgebaut werden sollten RGZ zunächst überall dort, wo hausärztliche Unterversorgung drohe oder bestehe, so von Maydell. Mit Blick darauf wären das deutschlandweit erst mal 50 bis 100 Standorte. Berücksichtigt werden sollten dabei aber auch bestehende Krankenhauskapazitäten und die Erreichbarkeit.
Während der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigte Basisvorschlag zur Krankenhausreform noch auf sich warten lässt, hat auch das Zukunftsinstitut mit Hilfe der Szenariotechnik vier Zukunftsbilder herauskristallisiert, die die Kliniklandschaft der kommenden Jahre neu zeichnen. „Wir entwickeln die Story einer künftigen Healthstyle-Welt, in der sich jede und jeder Einzelne nach der optimalen Betreuung und Versorgung sehnt. In der das System genug Kapazitäten für das Individuum hat. Und in der die Betreiber von Kliniken und die Mitarbeitenden in den Häusern eine Umgebung schaffen, die Ökonomie und Menschlichkeit miteinander versöhnt“, sagt Corinna Mühlhausen, Leiterin der Studie „Healthreport 2022“ des Zukunftsinstituts.
Vier Szenarien für die Klinik der Zukunft
Dem Szenario „Smart Hospital“ liegt die Grundannahme eines extrem hohen Digitalisierungsgrads zugrunde. Daraus resultiert auf Seiten der Patientinnen und Patienten ein großes Vertrauen in alle Formen von Internet-Medizin und gesundheitlicher Online-Beratung. Zudem ist die Alltagswelt voll digitalisiert. Eine Art Gesundheits-Facebook begleitet die Menschen durch ihren Tag, elektronisches Gesundheitstracking und E-Arztbesuche sind die erste Wahl. Die elektronische Patientenakte ist in der Hoheit des Einzelnen und jederzeit verfügbar. Vollautomatische und vereinfachte Patientendokumentation in allen gesundheitlichen Teilbereichen wird zur Selbstverständlichkeit. Ein hohes Involvement besteht in Bezug auf Weiterentwicklungen im Bereich des Smart Homes und vollvernetzten Klinikzimmers. Die 24/7-Überwachung von Körper, Geist und Seele ist Standard und versetzt die Patientinnen in die Lage, wesentlich früher in die eigene häusliche Umgebung zurückzukehren. Pharmazeutische Anwendungen auf Basis von Genotyping haben sich durchgesetzt, die Big Player im Krankenhausmarkt sind internationale Anbieter mit einem hochmodernen Markenimage.
Im Szenario „Living Clinic Community“ ist das Gesundheitssystem ähnlich vernetzt und globalisiert wie beim „Smart Hospital“. Allerdings geht dieses Zukunftsbild von der Annahme aus, dass es einen Backlash der Natur gegen die omnipräsente Digitalisierung gibt. Folglich fokussieren sich die Menschen auf eine Heilkunst zwischen Innovation und Tradition. Konkret wird dabei das alte Wissen des Heilens und verschiedener Heiler von TCM bis zur Medizin der Inka belebt und mit hochmodernen Wirkmechanismen kombiniert. Grundsätzlich haben die Patientinnen in diesem Szenario ein großes Interesse an allen Gesundheitsthemen und dem intensiven Austausch mit anderen darüber. Ärzte, Apotheker und Alternativmediziner sind gleichermaßen wichtige Vertraute – wenn sie es schaffen, für Transparenz zu sorgen.
Im Zukunftsbild „Slow Clinic“ ist der Fokus auf die Themen Natur und Vorsorge ähnlich ausgeprägt. Natur- und Alternativmedizin sowie alle komplementären Behandlungsoptionen genießen hier allerhöchstes Ansehen. Im Gegensatz zum Szenario der „Living Clinic Community“ bauen die Patientinnen und Patienten hier aber auf das Wissen ihrer Mütter und Vorväter: Regionalität und individuelle Lösungen, auch im Präventionsbereich, stehen ganz oben. Der eigene Apotheker oder die langjährige Hausärztin sind die wichtigsten Vertrauten in allen medizinischen Fragen. Sie werden optimalerweise in die Behandlung im stationären Fall mit einbezogen bzw. unterhalten ihre Praxisräume auf dem Klinikgelände. Die lokale Klinik ist im besten Fall tief verwurzelt mit der Region.
Beim Szenario „Me Clinic“ liegt der Fokus auf der Stärkung des Patienten und der Patientin im Hinblick auf die Eigenoptimierung. Die Menschen organisieren ihren Alltag hier und um die digitalisierten Möglichkeiten. Das Internet ist ein wichtiger Ratgeber – mit einem starken Fokus auf lokale Netzwerke. Empfehlungen, Verschreibungen und auch ein Teil der Untersuchungen werden auf elektronischem Weg von bekannten Ärzten und Apothekern realisiert. Mediziner aus dem niedergelassenen Bereich und das Krankenhaus kooperieren eng und niedrigschwellig. Terminvereinbarungen finden online statt, Konsultationen in einer Kombination aus on- und offline mit einem klar multimedial ausgerichteten Kommunikationsverhalten, das auch Messenger-Dienste und Videotelefonie selbstverständlich mit einbezieht.
„Es lohnt, bei der Umgestaltung der Krankenhäuser in Deutschland in den nächsten Jahren auf das zu schauen, was sich die Menschen wünschen – die Patientinnen und Patienten, aber auch alle Mitarbeitenden –, und das sind Zeit, Resonanz und eine Form von Konnektivität, die High Tech und High Touch integriert. Nur so können Zentren und Klinik-Marken entstehen, die ökonomisch und menschlich zugleich funktionieren“
, so Corinna Mühlhausen.
Neue Businessmodelle für die Kliniken gesucht
Das Future of Health-Prognosemodell der Unternehmensberatung Deloitte geht noch mehr in die Tiefe. „Auf Basis unseres Future of Health-Prognosemodells gehen wir davon aus, dass in den kommenden Jahren mit einem durchschnittlichen, jährlichen Verlust von ca. einem Prozent der stationären Patientenzahlen zu rechnen ist. In 2025 ist so von rund 19 Millionen stationären Fällen auszugehen, das heißt einem Rückgang um fünf Prozent bzw. ca. 920.000 Fällen im Vergleich zu 2019“, sagt Ibo Teuber, Partner im Bereich Health Care bei Deloitte. „Durch reduzierte stationäre Patientenzahlen wird der Druck auf die Krankenhäuser signifikant zunehmen. Der Aspekt der Wirtschaftlichkeit wird daher weiter von großer Bedeutung sein. Wer es nicht schafft, den Wandel als Chance zu sehen und sich mit neuen Businessmodelle zu platzieren, wird in naher Zukunft im Gesundheitsmarkt nicht mehr existieren können.“
Teuber ist überzeugt: Durch neue Player im Ökosystem werden die Grenzen des Krankenhausbetriebes zunehmend verschwimmen. Technologieriesen wie Amazon oder Google etablieren sich bereits im Gesundheitsmarkt und haben durch ihr digitales und technisches Know-how Zugang zu Patienten, den Kunden von morgen, und ihren Daten, sowie bewährte Analyseexpertise und -funktionen. Dadurch können Sie das „nahtlose“ Patientenerlebnis mit radikal interoperablen Daten und offenen, aber sicheren Plattformen ermöglichen. „Krankenhäuser müssen sich entscheiden, wo sie zukünftig ihren Platz finden“, so Teuber. „Durch die Neuordnung des Gesundheitssystems werden marginale Anpassungen der Krankenhäuser, wie sie in der Vergangenheit erfolgt sind, wie bespielsweise ambulante Angebote, Erwerb von MVZs oder Kooperationen, nicht ausreichen.
Die neuen Businessmodelle müssen nicht nur über die Sektorgrenzen, sondern auch über die Industriegrenzen in Richtung Technologieindustrie hinausgedacht werden. Welche Rolle ein Krankenhaus in Zukunft im Ökosystem des Gesundheitswesens einnimmt, kann und muss variieren.“